Falsch eingestiegen - eine halbe Stunde in der Hölle
Notizen zur sterbenden Ästhetik des Abschieds
von Andreas Mertin
aus: Magazin für Theologie und Ästhetik 1/1999
https://www.theomag.de/1/am8.htm
6. September 1998.
Ich befinde mich im Interregio von der Nordseeküste ins Ruhrgebiet. Es ist der vorletzte Interregio von den Inseln. Der Zug ist zum Bersten voll mit Kegelklubs und wochenendausfliegenden Verkäuferinnen. Im Nachbarabteil eine feuchtfröhliche Runde, sie schmettert Gassenhauer und Wolfgang Petry Lieder. Man tanzt und singt mehr als lautstark. Jeder sich Vorbeizwängende wird angemacht, der Alkohol kreist. Wenige Minuten vor Meppen verlangsamt der Zug seine Fahrt und bleibt schließlich stehen. Unruhe breitet sich aus, neugierig recken sich Gesichter aus den Fenstern. Zwei Schaffnerinnen, die gerade den Zug kontrollierend durchgearbeitet haben, öffnen eine Tür, blicken nach vorne und konstatieren als Verzögerungsursache eine offen gebliebene Bahnschranke. Dann kommt die Durchsage des Zugchefs: Wegen eines Personenschadens verzögert sich die Weiterfahrt des Zuges auf unbestimmte Zeit.
Im Bruchteil einer Sekunde wandelt sich die Unsicherheit der Reisenden in blanke Wut: So ein Idiot. Kann er sich nicht einen Strick nehmen oder sich erschießen? Muß er uns damit belästigen? Die ersten Reisenden zücken cool ihr Handy und informieren irgendwelche Wartenden über die drohende Verspätung: Du, ich steh' hier vor Meppen, weiß nicht, wie lang' das dauert. Richtet Euch mal aufs Warten ein. Unter den anderen festsitzenden Reisenden weiterhin unverhohlene Wut. Was denkt der sich denn? Jetzt komme ich zu spät! Kann der bei seinem Tod nicht an andere denken? Kein Gedanke daran, daß eventuell ein Kind Opfer eines Unfalls gewesen sein könnte oder jemand aus anderen Gründen einen Zugunfall verursacht hätte.
Die sangesfreudige Gruppe junger Damen im Nachbarabteil hat zwischenzeitlich ihr Programm wiederaufgenommen: Lautstark schmettert es durch den Wagen: Ich war, ich war, ich war noch nicht auf Hawaii! Die Zugschaffnerin kommentiert die Lage währenddessen sachkundig: Das war'n nicht wir. Das war der entgegenkommende Zug. Dabei beginnt die Saison doch jetzt erst (gemeint ist die 'Saison' der Deutsche Bundesbahn Selbstmörder).
Kurz darauf entstehen im Zug die ersten ethischen Konflikte: mann/frau hat soviel Bier gebechert, daß mann/frau im 20-Minuten-Rhythmus zur Toilette muß. Jetzt wäre es wieder so weit. Aber darf mann/frau bei einem stehenden Zug auf die Toilette gehen? Wenn er wenigsten auf offener Strecke hielte. Aber zufälligerweise steht er genau an einem Kleinstbahnhof und auf fast jedem deutschen Zugklo stehen nun einmal die bedeutungsschweren Worte: Die Benutzung des WC ist während des Aufenthalts auf Bahnhöfen nicht gestattet. Lange Diskussion: Ab wann ist eine drückende Blase ein ethischer Notfall, der die Übertretung bundesdeutscher Zug-WC-Verwendungsregeln gestattet? Dann ein rasches Bekenntnis zur Regelverletzung: rege Frequentierung der Toilette. Neben der ausgestiegenen Zugschaffnerin tröpfelt es auf die Gleise.
Einige Zeit später kündet der Zugchef: In Kürze werden wir unsere Fahrt fortsetzen können! Empörte Rufe: Was heißt hier in Kürze? Das ist eine Zumutung! Die Damenrunde im Nachbarabteil wechselt zwischenzeitlich auf die in Interregios besonders beliebten Wolfgang Petry-Lieder und intoniert: Jetzt ist Schluß mit lustig ... Der Zug setzt sich nach knapp 20 Minuten Wartepause langsam in Bewegung. Man nähert sich der Unglücksstelle. Alles hastet an die Zugfenster auf der linken Seite, um sich nur kein Detail entgehen zu lassen. Währenddessen hat der Damenchor im Nachbarabteil den passenden Wolfgang Petry Song gefunden: Augen zu und vorbei ... Von den Fenstern an der linken Zugseite vereinzelte Rufe: Entsetzlich! Und das muß man sich ansehen! Der Zug beschleunigt, Normalität setzt ein. Wir erreichen Meppen. Neu eingestiegene Zugreisende werden ebenso beiläufig wie sachkundig informiert: ein abgerissener Arm, ganz kaputt; lag 'ne einzelne Hand rum, war nicht schön. Der Zug summt: Die Karawane zieht weiter, der Sultan ....
Am 6.9.1998 verstarb auf der Zugstrecke zwischen Meppen und Papenburg ein Mensch durch eine selbst herbeigeführte Gewalteinwirkung. Keiner der Reisenden kannte ihn und er war ihnen nur eine Belastung.
Zwei Tage später meldet die lokale Presse:
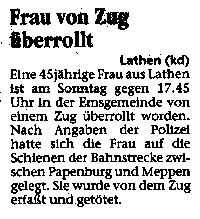
Man kann die Situation unterschiedlich kommentieren und erklären. Ein befreundeter Theologe, dem ich die Geschichte erzählte, deutete sie als Verdrängung und Abwehr, als eine Form der Tabuisierung des Todes. Bloß nicht mit dem Tod konfrontiert werden! Man kann natürlich auch darauf verweisen, daß die Reisenden in starkem Maße alkoholisiert waren. Daß sie nicht wußten, was sie sagten und gar nicht in der Lage waren, in dieser Situation an eine verzweifelte Selbstmörderin und deren Lebensgeschichte oder an eine andere Unfallursache zu denken.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den Vorgang ausreichend beschreibt. Mein spontaner Eindruck war, daß unter einer dünnen Kruste von Zivilisation die Barbarei steckt. Natürlich spielt die Verdrängung eine Rolle, natürlich lockert der Alkohol die Zunge, so daß man etwas sagt, was man vielleicht unter anderen Umständen nicht gesagt hätte. Aber ich glaube eher, daß die Reisenden unter diesen Umständen ganz einfach die Wahrheit gesagt haben. Es war ihnen gleich gültig, ob es sich um einen Selbstmord, einen technischen Defekt oder den Unfall eines Kindes handelte, wichtig war ihnen nur, daß sie in ihrer Planung des Tagesablaufs gestört wurden.
"Die funktionsspezifisch ausgelegte Systemrationalität der Gesellschaft sieht den Tod gleichsam nicht vor", schreibt der Praktische Theologe Wilhelm Gräb. "Wenn er trotzdem passiert, z.B. bei Tempo 180 auf der Autobahn verursacht dies kurzfristig eine störende Beeinträchtigung im Funktionsmechanismus, z.B. des Verkehrssystems (die Vorbeikommenden fahren für eine Weile etwas langsamer), aber eine unsere Lebenspraxis und unser Lebensverständnis insgesamt betreffende Kommunikation wird dadurch nicht ausgelöst. Die Gesellschaft entzieht sich sozusagen jeder Zumutung, sich auch noch zu denjenigen Ereignissen explizit zu verhalten, die nicht das Resultat ihrer funktionsspezifisch ausgelegten Handlungsrationalität sind." Im vorliegenden Fall konnte m.a.W. keine Intimität, keine Geschichte mit der Toten aufgebaut werden, andere Gefühle standen deshalb im Vordergrund.
Das anschließende Interesse der Zugreisenden an der Beobachtung der Unfallstelle und des Leichnams gehört m.E. ebenfalls nicht zur Ästhetik des Abschieds. Im Fernsehen war zwar zu hören, daß es inzwischen einen Katastrophentourismus nach Eschede gibt, obwohl dort gar nichts mehr vom ICE-Unfall selbst zu sehen ist. Der Ort hat sich, so könnte man argumentieren, ganz einfach qualitativ verändert. Es ist eine Art heiliger Ort geworden. (Hier wurden 101 Menschen dem technischen Fortschritt der Deutschen Bundesbahn geopfert). Analoge Phänomene beobachtet man ja auch an Orten von Autounfällen mit 'Personenschaden'. Hier werden Kreuze aufgestellt und Blumen abgelegt, wird das scheinbar Unfaßliche in Trauerarbeit bewältigt. Im vorliegenden Fall freilich gab es keine Bewältigung durch Trauerarbeit, eher diente der unheilige Blick dem Aggressionsabbau. Man wollte - neben dem Kick, den der "Personenschaden" für den Zuschauer darstellt - sehen, ob der Verursacher der Betriebsstörung seine Strafe - den Tod - auch bekommen hat. Eine paradox-archaische Forderung: Todesstrafe für Selbstmörder.
|